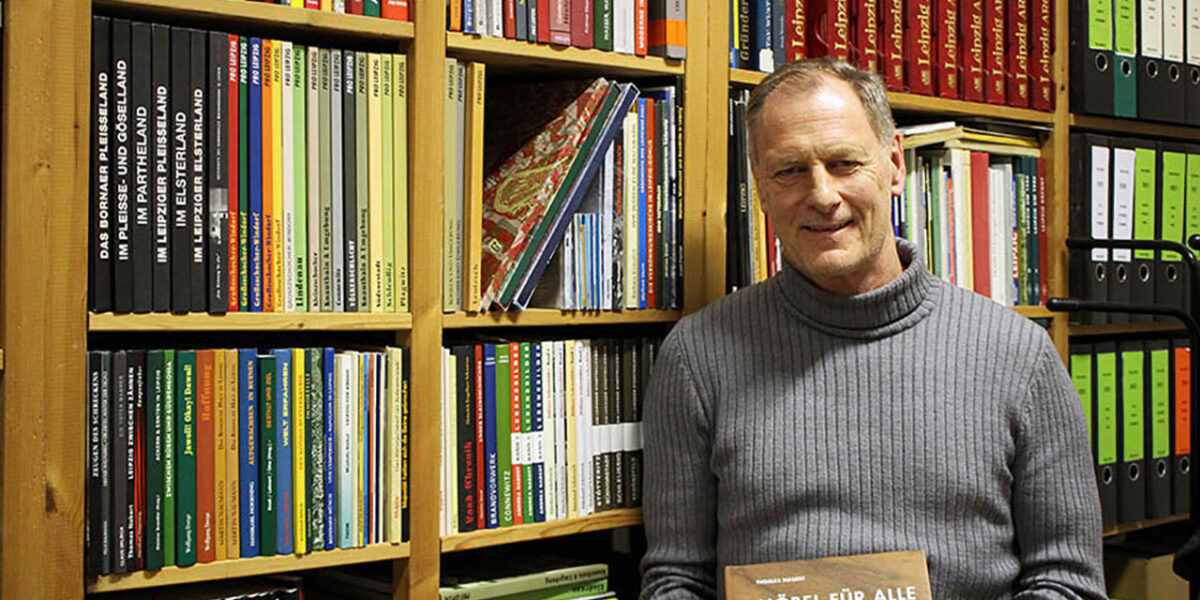Deutschlandweit bekannt wird er als Tierpfleger Conny Weidner. Das ist die gute Seele des Zoo Leipzig in der ARD-Fernsehserie „Tierärztin Dr. Mertens“. Kabarettist und Schauspieler Thorsten Wolf bietet sogar Filmführungen an seine Drehorte an, etwa in den Wildpark Leipzig oder ins historische Stadtbad. Vor der Kamera steht er auch für andere Projekte, darunter mehrmals für den „Polizeiruf 110“ oder in die MDR-Serie „In aller Freundschaft“. In der Musikalischen Komödie ist er als Frosch in der „Fledermaus“ zu sehen. Für ihn ein Ritterschlag, wie er sagt. Das eigene Kabarett, die Leipziger Funzel in der Strohsack-Passage in der Nikolaistraße, hat er im Oktober 2023 allerdings geschlossen.
Bildergalerie - Wolf, Thorsten
Geboren wird Thorsten Wolf am 2. Februar 1965 in Leipzig. Er wächst in Connewitz auf, geht dort in die Karl-Jungbluth-Oberschule in der Bornaischen Straße. Geprägt hat ihn, wie er sagt, das Kiez-Kino UT Connewitz in der Wolfgang-Heinze-Straße, wo er unzählige Filme gesehen hat sowie der Eckladen „Die süße Anna“ am Spielplatz Herderplatz, wo er viel Lutscher und Lakritze kaufte. Viele Jahre habe er in der Hildebrandstraße, später in der Prinz-Eugen-Straße gewohnt. Ein „Südstaatler“, wie er betont.
Ein komisches Talent fürs Kabarett
Nach der Schulzeit erlernt er den Beruf eines Klempners und Sanitärinstallateurs im damaligen Bau- und Montagekombinat Süd. Doch es drängt ihn zur Bühne. Deshalb macht er ab 1984 zunächst beim Amateurkabarett „Baufunzel“ des Betriebes mit, welches aus den „Büroklammern“ hervorgegangen ist. Von 1987 an tritt die „Baufunzel“ öffentlich in Klubs und Klubhäusern auf, darunter in der „Nelke“ in Grünau, im BMK Süd (heute Amtsgericht) sowie im „Klubhaus der Freundschaft“. Wolf selbst wird rasch zum führenden Kopf des Betriebskabaretts, das als Volkskunstkollektiv, wie es damals heißt, zahlreiche Preise gewinnt. Er ist ein geselliger Typ und liebt es, sein komisches Talent auszuleben.
Nach der Friedlichen Revolution wird das Ensemble freiberuflich tätig. Es gibt sich den neuen Namen Kabarett „Leipziger Funzel“. Das Logo, darunter die Banane, entwickelt Reiner Schade. Und Thorsten Wolf – damals 26 – wird jüngster Theaterdirektor Ostdeutschlands. Das erste Gastspiel in den Westen führt 1990 in Leipzigs Partnerstadt Hannover.
Die eigene Bühne in der Strohsackpassage
Ab 1992 hat das Ensemble seine Spielstätte in der Nikolaistraße 12-14 im Haus „Zum Rosenkranz“. 1997 bezieht die „Leipziger Funzel“ ihr eigenes Domizil in der Strohsack-Passage. Es beginnen aufregende Zeiten, mit vielen Höhen und Tiefen. Die Vorstellungen sind erfolgreich. Viele bekannte Gaststars aus der Kabarett- und Comedyszene kommen gern zu Gastspielen. Für viele, wie Götz Alsmann, Dieter Nuhr, Karl Dall oder Hella von Sinnen wird es ein Test, wie sie beim Publikum im Osten ankommen. Ein Tiefschlag ist der Tod des Bruders Tobias, mit dem er einst das Kabarett-Theater als Familienunternehmen aufgebaut hat.
Am 31. Oktober 2023 ist Schluss – das Kabarett wird geschlossen. Das ist das Ergebnis langer Überlegungen aus Altersgründen und „aus unternehmerischer Verantwortung“, wie er sagt. Wolf favorisiert einen geplanten Abgang mit Applaus, will nicht mit einem überalterten Ensemble nebst Publikum zugrunde gehen. „Ensemble-Kabarett funktioniert nicht mehr so gut wie früher“, sagt er. „Das Publikum möchte derzeit lieber Gastro-Events, Dinnerbuffets und Brunchhows.“ Das wiederum ist nicht unbedingt Wolfs Ding. Zudem sei der Mietvertrag ohnehin ausgelaufen.
Der Keller in der Strohsack Passage ist längst geräumt. Viele der über Jahrzehnte angesammelten Devotionalien haben über den Flohmarkt neue Besitzer gefunden. Selbst die Bürste seines Klomanns Willi hat der Funzel-Chef versteigert.
Mit der Kneipe „Dr. Faustus“, dem Nachfolger der „First Whisk(e)y Bar“, ist noch ein Stückchen der alten „Funzel“ erhalten geblieben. Ebenso der Kabarett-Stammtisch mit etwa 26 Mitarbeitern. Neben den vielen Terminen in der Leipziger Kulturszene gibt es für Thorsten Wolf immer noch genug zu tun. Nicht nur im Fernsehen. 2025 übernimmt er Regie für das neue Programm „Harakiri to go“ der Leipziger Pfeffermühle. Angebote, eigene Solo-Programme aufzulegen, lehnt er bislang ab. Er will nicht mehr, wie in den vorangegangenen 35 Jahren, viele Abende über einen längeren Zeitraum auf der Bühne stehen. „Wenn Not am Mann ist, springe ich aber zeitlich begrenzt ein.“ Vor allem als Regisseur.
Seine Leidenschaft ist das Reisen
Der gebürtige Leipziger, der Tiere und die Natur liebt, lebt seit 2012 in Taucha. Deshalb ist die Rolle des Cheftierpflegers in der ARD-Fernsehserie ihm auch wie auf den Leib geschrieben. Auf die Tierszenen bereitet er sich akribisch vor. Auf zahlreichen Reisen hat er viele Tierarten auch schon in ihrem natürlichen Umfeld erlebt, etwa die Gorillas in Uganda. Thorsten Wolf ist gern unterwegs, um andere Länder und Menschen kennenzulernen.
Bislang hat er 134 Länder bereist, wie er nicht ohne Stolz sagt. Und auch Vorträge darüber gemacht. Die nächsten Ziele, etwa Südgeorgien und die Falkland-Inseln mit den Kaiserpinguinen, stehen fest. 2026 ist ein Projekt „Wolfsgeheul“ über sein Leben als Schauspieler mit vielen Anekdoten im Central Kabarett Leipzig geplant. Ein Team hat ihn zudem über ein Jahr lang begleitet, um einen Dokumentarfilm zu drehen. In seiner Freizeit ist Wolf leidenschaftlicher Skatspieler, darunter auch Ehrenvorsitzender bei den Muldenperlen in Grimma. Nach wie vor ist er beratend tätig, wenn es um Kulturförderung in Leipzig geht.
Stand: 21.02.2025