
Städte Leipzig, Markkleeberg und Zwenkau | Angrenzende Ortsteile: Knauthain, Großzschocher, Gemarkung Lauer im Südwesten der Stadt Leipzig, Markkleeberg und Zwenkau

Städte Leipzig, Markkleeberg und Zwenkau | Angrenzende Ortsteile: Knauthain, Großzschocher, Gemarkung Lauer im Südwesten der Stadt Leipzig, Markkleeberg und Zwenkau

Veranstaltungsmanager, Grabredner, Impressario | geb. am 23. Januar 1954 in Leipzig; gestorben am 15. Januar 2020 in Bad Klosterlausnitz

Liebigstraße 28 | Ortsteil: Zentrum-Südost
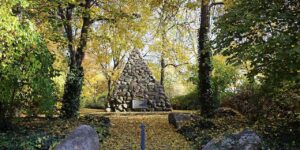
Gustav-Schwabe-Platz, Naunhofer Straße/Ludolf-Colditz-Straße | Ortsteil: Stötteritz

Lehrer, Politik- und Erziehungswissenschaftler, Verbandschef Völkerschlacht | geb. am 18. August 1975 in Leipzig