
Friedhofsforscher, Spezialist für Begräbniskultur, Autor, Publizist | geb. am 27. September 1952 in Kleve
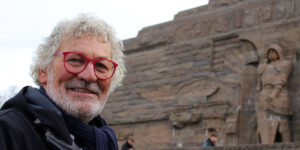
Steinmetzmeister, Restaurator | geb. am 4. April 1953 in Leipzig

Arno-Nitzsche-Straße 35 / Stadtwerke-Gelände Leipzig Südost | Ortsteil: Connewitz