
Regisseur, Kabarettist, Schriftsteller | geb. am 6. Mai 1947 in Marx (Russische Föderation)

Gutenbergplatz 3 und 5 / Gerichtsweg 24 | Ortsteil: Zentrum-Südost

Nonnenstraße 17-21 und Holbeinstraße 14, 16, 18a-18h | Ortsteil: Plagwitz und Schleußig
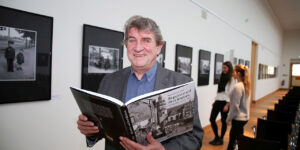
Tourismus-Innovator, Kultur-Manager, Ausstellungsgestalter,
geb. 3. Juni 1949 in Leipzig