
Markt / Augustusplatz und weitere Plätze und Straßen der Innenstadt | Ortsteil: Zentrum
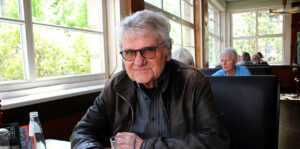
Kabarettist, Autor, Germanist | geb. am 15. Juli 1944 in Ebersbach (Sachsen)

Diplomhistoriker, Museologe, Fotoarchivar | geb. am 14. September 1955 in Markranstädt

Kunsthistorikerin, Museumsdirektorin, Buchwissenschaftlerin | geb. am 21. Februar 1963 in Unna/Westfalen

Willy-Brandt-Platz 2 / Gerberstraße / Kurt-Schumacher-Straße | Ortsteil: Zentrum
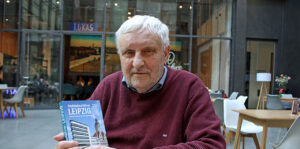
Architekturhistoriker, Denkmalpfleger, Autor | geb. am 25. September 1947 in Osterfeld